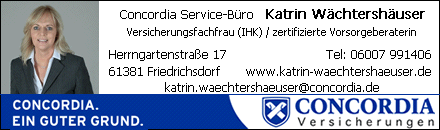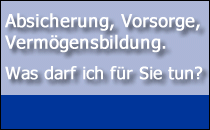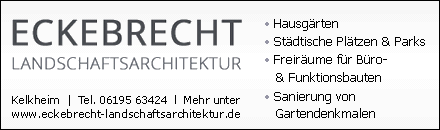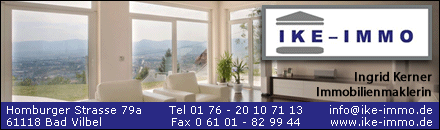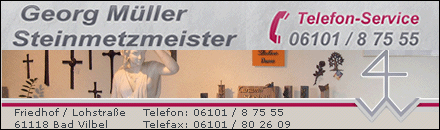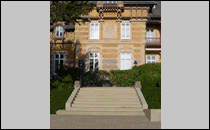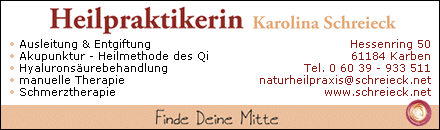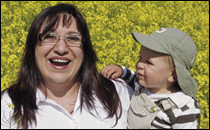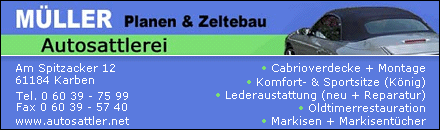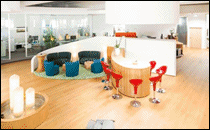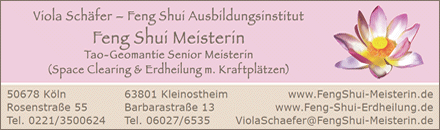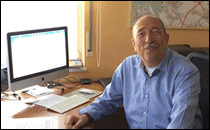Bad Homburg vor der Höhe (amtlich Bad Homburg v. d. Höhe) ist die Kreisstadt des Hochtaunuskreises in Hessen und eine von sieben Sonderstatusstädten des Landes. Sie liegt in 137 bis 250 Metern Höhe über Normalnull (im Mittel 192 Meter) und hat etwa 52.000 Einwohner. Bad Homburg liegt im Ballungsraum Rhein-Main und grenzt direkt an Frankfurt am Main. Der Zusatz „Bad“ wird seit 1912 geführt. Die Kurstadt gilt ebenso wie weitere Taunusstädte als bevorzugter Wohnort besserverdienender Berufspendler nach Frankfurt am Main, ist aber auch Sitz zahlreicher Unternehmen, sodass mehr Berufstätige nach Bad Homburg ein- als auspendeln. Bad Homburg grenzt im Norden an die Gemeinde Wehrheim und die Stadt Friedrichsdorf, im Osten an die Städte Rosbach vor der Höhe und Karben (beide Wetteraukreis), im Süden an die kreisfreie Stadt Frankfurt am Main, im Südwesten an die Stadt Oberursel (Taunus) sowie im Nordwesten an die Stadt Neu-Anspach. Stadtgliederung Die Eingemeindung der umliegenden Dörfer setzt 1901 mit Kirdorf ein. 1937 folgen Gonzenheim und schließlich 1972 im Zuge der großen Kreis- und Gemeindereform Ober-Eschbach, das weiter außen liegende Ober-Erlenbach und Dornholzhausen. Bereits in mittelalterlicher Zeit kam es zur Übernahme des Dorfes Mittelstedten, wobei hier lediglich die Bevölkerung in die Stadt umgesiedelt und das Dorf aufgegeben wurde.
Neben den Eingemeindungen sind vor allem die in der Zeit der Hugenottenansiedlung von Homburg ausgehende östlich gelegene Neugründung Friedrichsdorf (heute selbstständig), sowie die Wiederansiedlung von Menschen auf dem Gebiet der Wüstung Dornholzhausen (heute: Stadtteil von Bad Homburg) zu nennen. Der Name der Stadt Homburg leitet sich von der Burg Hohenberg ab. Die Stadt Homburg, das heutige Bad Homburg, ist urkundlich erstmals um 1180 nachgewiesen. Archäologische Untersuchungen haben für den gleichen Zeitraum Nachweise von Besiedlung erbracht. Die Zuschreibung einer Erwähnung Villa Tidenheim = „Dietigheim“ im Lorscher Codex aus dem Jahr 782 für die Stadt ist daher unwahrscheinlich. Für die Annahme, Homburg habe um 1330 Stadt- und Marktrecht erhalten, gibt es ebenfalls keine eindeutigen Beweise, denn eine entsprechende Urkunde liegt nicht vor. 1335 gestattete allerdings Kaiser Ludwig IV., genannt der Bayer, den Herren von Eppstein, in dem zu ihrem Territorium gehörenden „Dal und Burg zu Hoenberg“ ebenso wie in Steinheim und Eppstein je zehn Juden anzusiedeln. Da Ludwig den beiden ebenfalls genannten Orten bereits Stadtrechte verliehen hatte[2], wird angenommen, dass dies auch für Homburg zutraf; im 15. Jahrhundert wird Homburg nur noch Stadt genannt. 1486 verkauft Gottfried X. von Eppstein Homburg für 19.000 Gulden an Graf Philipp I. von Hanau-Münzenberg. 1504/1521 verlor Hanau Homburg wiederum an die Landgrafschaft Hessen. Mit deren Teilung nach dem Tod des Landgrafen Philipp I., fielen Burg, Amt und Stadt Homburg an Hessen-Darmstadt, 1622 an die Nebenlinie Hessen-Homburg. 1866 fiel Homburg nach dem Aussterben des Landgrafengeschlechts von Hessen-Homburg an das Großherzogtum Hessen-Darmstadt zurück, wurde jedoch im gleichen Jahr in Folge des Preußisch-Österreichischen Kriegs preußisch. Mit Aufkommen des Kurbetriebs ab Mitte des 19. Jahrhunderts, der sehr von der Einrichtung einer Spielbank profitierte, wandelte sich die Stadt zu einem international berühmten Bad. Nach 1888 wurde Bad Homburg Sommerresidenz von Kaiser Wilhelm II. Horex war eine bekannte deutsche Motorradmarke der Horex – Fahrzeugbau AG, die 1923 von Fritz Kleemann in Bad Homburg gegründet wurde. Während der Kurbetrieb als Folge der beiden Weltkriege jahrelang stark zurückging, nahm die Bedeutung der Stadt als Sitz von Behörden und Verwaltungen zu. Schon im Herbst 1946 ordnete die Militärregierung die Gründung bizonaler Behörden an. Sitz der Verwaltungsstelle für Finanzen wurde Bad Homburg. Hier richtete am 23. Juli 1947 der Wirtschaftsrat der Bizone zur Vorbereitung der Währungsreform die „Sonderstelle Geld und Kredit“ ein, deren Leiter Ludwig Erhard wurde. Nach der Gründung der Bundesrepublik mit der Hauptstadt Bonn blieben in Bad Homburg noch die Bundesschuldenverwaltung (ab 2002 umbenannt in Bundeswertpapierverwaltung, seit 1. August 2006 Teil der Deutschen Finanzagentur), das Amt für Wertpapierbereinigung und das Bundesausgleichsamt. Im 20. Jahrhundert wurde Bad Homburg zu einem bevorzugten Wohnsitz der Frankfurter Oberschicht. Am 30. November 1989 wurde eines ihrer Mitglieder, der hier wohnende Vorstandssprecher der Deutschen Bank AG, Alfred Herrhausen, durch ein Sprengstoffattentat getötet, zu dem sich die Rote Armee Fraktion (RAF) bekannte. Eine endgültige Aufklärung des Verbrechens ist bis heute nicht erfolgt. Bad Homburg war nie eine kreisfreie Stadt und hatte daher zunächst keinen Oberbürgermeister. Kaiser Wilhelm II., der regelmäßig im Schloss residierte, verlieh den seit 1892 amtierenden Bürgermeistern als persönliche Auszeichnung den Titel Oberbürgermeister, wenn auch zum Teil erst ein bis zwei Jahre nach ihrem Amtsantritt als Bürgermeister. Nach dem Ende der Monarchie wurde diese Bezeichnung den Stadtoberhäuptern nicht mehr verliehen. Partnerstädte/Patenstadt Projektpartnerschaften Die überdurchschnittlich hohe Kaufkraft der ansässigen Bevölkerung ist für den Bad Homburger Einzelhandel sehr vorteilhaft, ein Teil fließt in den angrenzenden Frankfurter Einzelhandel ab. Politisch wird die Innenstadt attraktiv gehalten, Ansiedlungen, zum Beispiel von Discountmärkten in Stadtrandlage, sind verboten. Dies führte zu einer rapiden Expansion der an das Bad Homburger Stadtgebiet angrenzenden Industriegebiete in Frankfurt-Nieder-Eschbach und Frankfurt-Kalbach-Riedberg. Inzwischen überragt gemessen an Nachbarorten mit ebenfalls hoher Kaufkraft Bad Homburg: rund 96 von 100 Euro werden auch hier ausgegeben (Oberursel (Taunus): knapp 66 Euro, Königstein im Taunus: 51 Euro, Kronberg im Taunus: 30 Euro). Die besonders hohe Lebensqualität, die Bad Homburg bietet, führt dazu, dass die Bodenpreise in Bad Homburg zu den höchsten in der ganzen Bundesrepublik zählen. In Bad Homburg haben unter anderem folgende Unternehmen ihren Sitz: Amadeus Germany GmbH, Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft, Bridgestone Deutschland GmbH, DELTON AG, Deutsche Leasing AG, Feri Finance AG, Fresenius SE, Fujitsu, Hewlett-Packard GmbH, ixetic GmbH, Lilly Deutschland GmbH, Linotype GmbH, MEDA Pharma GmbH & Co. KG, PIV-Drives GmbH, RINGSPANN GmbH (ein Unternehmen der Antriebs- und Spanntechnik mit 240 Arbeitsplätzen in Bad Homburg) sowie die Quandt-Gruppe. Daneben ist die Stadt Sitz des Bundesausgleichsamtes, der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, der AOK Hessen, der Spielbank Bad Homburg und des Fernsehsenders rheinmaintv. Mit der Landgräflich Hessischen concessionierten Landesbank in Homburg war Bad Homburg zwischen 1855 und 1876 Sitz einer Notenbank. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Bundesschuldenverwaltung ihren Sitz in Bad Homburg. Bad Homburg ist einer der beiden Sitze der TaunusSparkasse. Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist der Kurbetrieb, der auf die zahlreich vorhandenen Heilquellen gründet. Zentrum des Kurbetriebs ist das 1982 bis 1984 errichtete, postmoderne neue Kurhaus. Das traditionelle Kaiser-Wilhelms-Bad liegt im Kurpark Bad Homburg, einem 44 Hektar großen Park im englischen Landschaftsstil (Entwurf von Peter Joseph Lenné) am Ostrand der Innenstadt. Der untere Teil des Parks ist vor allem für die vielen Brunnen bekannt, die relativ dicht beieinander liegen, aber zum Teil sehr unterschiedliche Mineraliengehalte aufweisen.
Eine Reihe von Kliniken bieten Heilbehandlungen aller Art an. Neben den Hochtaunus-Kliniken, den Kliniken des Hochtaunuskreises sind dies unter anderem die Wickerklinik, Klinik Wingertsberg, Klinik Dr. Baumstark und die Paul-Ehrlich-Klinik. Neben dem Kurbetrieb bietet Stadt und Umgebung insbesondere Tagesgästen bekannte Sehenswürdigkeiten:
Bad Homburg ist durch die S-Bahn-Linie S5 (Homburger Bahn) mit Frankfurt verbunden. Der Bahnhof Bad Homburg ist weiterhin Endbahnhof der kommunalen Taunusbahn, die die Kreisstadt mit den Orten des Hintertaunus verbindet und in den Hauptverkehrszeiten nach Frankfurt Hauptbahnhof weitergeführt wird. In Bad Homburg existiert ein Stadtbusnetz, welches neun Tages- und sechs Abendlinien umfasst, sowie an Wochenenden einen Nachtbus nach Frankfurt am Main. Betreiber der Busse ist seit 1. Januar 2009 die Verkehrsgesellschaft Mittelhessen GmbH (VM). Die Linien wurden zum genannten Datum in Bad Homburg und Oberursel (Taunus) aufgrund einer europaweiten Ausschreibung abgegeben. Zuvor war die Connex-Tochter Alpina Bad Homburg GmbH Betreiber im Auftrag der Stadt. Seit 1995 sind alle Verkehrslinien im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) zusammengefasst. Von 1899 bis 1935 gab es die elektrische Straßenbahn Bad Homburg vor der Höhe der EAG vorm. W. Lahmeyer & Co. Dazu gehörte die 1900 eröffnete Saalburgbahn zum Römerkastell Saalburg im Taunus. Von 1910 bis 1962 fuhren elektrische Züge der Frankfurter Lokalbahn AG von Frankfurt kommend entlang der Louisenstraße bis zum Markt, dann nur noch zum Alten Bahnhof (heute Rathaus). Die Strecke wird seit dem 19. Dezember 1971 von der Stadtbahnlinie U2 nur noch bis in die Stadtteile Ober-Eschbach und Gonzenheim befahren. Derzeit wird das Planfeststellungsverfahren vorbereitet, um diese Stadtbahnlinie bis zum Bad Homburger Bahnhof weiterzuführen. Frühere Überlegungen, die U-Bahn durch Bad Homburg bis zum Sportzentrum Nordwest und sogar über die Saalburg in den Hintertaunus zu verlängern, um den Pendlern auf der überlasteten Bundesstraße 456 einen Anreiz zum Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu geben, sind derzeit reine Utopie. Bad Homburg liegt am Fuß des Saalburgpasses, der Straßenverbindung zwischen Frankfurt und dem Usinger Land. Heute verläuft hier die vielbefahrene Bundesstraße 456. Der Umbau der Peters-Pneu-Kreuzung in Bad Homburg, durch eine Tunnellösung zur Vermeidung des täglichen Staus, ist in Bad Homburg politisch hoch umstritten. Drei Abfahrten der Bundesautobahn 661 erschließen Bad Homburg. Das Bad Homburger Kreuz stellt die Kreuzung zwischen der Bundesautobahn 661 und Bundesautobahn 5 dar.
Um das Schloss Bad Homburg erstreckt sich der Schlosspark Bad Homburg, ein nach englischem Vorbild entstandener Landschaftsgarten und Teil der Landgräflichen Gärten Bad Homburg. Im Kurpark stehen Denkmäler und Denksteine für Friedrich Hölderlin, Peter Joseph Lenné, Wilhelm Filchner, Maximilian Oskar Bircher-Benner, die Kaiser Wilhelm I., Wilhelm II. und Friedrich III. sowie seiner Gattin Victoria. Im Forstgarten befindet sich das Naturdenkmal Krausbäumchen (eine Süntel-Buche). Die Felsengruppe Rabenstein, ebenfalls ein Naturdenkmal, ist bei Kirdorf zu finden. Auf dem Waisenhausplatz wurde 1875 das Kriegerdenkmal 1870/71 errichtet. Zwischen Taunus-Therme und Seedammbad erinnern drei Granitstelen an den an dieser Stelle ermordeten Alfred Herrhausen. Etwa sieben Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums erhebt sich mit 591 Metern der Herzberg mit einem Aussichtsturm. Villa Tidenheim ist eine Ortsbezeichnung (Mittellateinisch villa = Dorf, Dorfmark, Siedlung, Hof) im Lorscher Codex. Sie erscheint in dieser Schreibweise nur einmal urkundlich, und zwar mit Bezug zu einer Schenkung eines gewissen Scerphuin in Tidenheim an das Kloster Lorsch „an dem 13. kalenden des April im 14. (Regierungs-)Jahr des Königs Karl“ - das war der 20. März des Jahres 782. In dieser Schenkung wird auch eine Kirche erwähnt. Die Eintragung führt an, dass der Abt des Klosters damals Gundeland war - ein Irrtum, denn Gundeland war bereits 778 gestorben. Im Lorscher Codex finden sich weitere ähnlich klingende Ortsbezeichnungen (Ditincheim, Titincheim, Tintingheim, Tittingesheim) mit unterschiedlichen Zeitangaben, die sich auf eine Siedlung im Niddagau beziehen. Auch in den Eppsteinschen Lehensverzeichnissen werden etwa Dyedenkeim und Didencheim genannt. Allgemein wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um unterschiedliche Schreib- und Bildungsweisen des Namens eines einzigen Dorfes handelt, da das Mittelalter noch keine verbindliche Rechtschreibung von Ortsbezeichnungen kannte. Die heutige Schreibweise ist Dietigheim. Sprachwissenschaftlich ist allerdings festzustellen, dass Tidenheim und Dietigheim zwar aus dem Personennamen Tido/Dito bzw. einer Ableitung davon gebildet wurden, an die dann die Endung „-heim“ angehängt wurde. Grammatisch gesehen unterscheiden sich aber beide Formen; gab es also doch zwei verschiedene Dörfer? Dafür spricht, dass im Codex Eberhardi des Klosters Fulda wiederholt der Name "Dito" erscheint, z. B. ein "Dito comes" genannt wird, der dem Kloster in der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts Schenkungen machte. "Dito" ist als Eigenname also verbürgt und damit auch seine Verwendung in dem "-heim"-Ort "villa Tidenheim", wobei es im Codex Eberhardi jedoch keinen Hinweis auf eine Verbindung zum "comes" gibt. C.D. Vogel führte 1843 in seiner „Beschreibung des Herzogthums Nassau“ aus, Tidenheim habe bei Eschborn gelegen und sei 875 durch ein „Hochgewitter“ zerstört worden, jedoch erinnere noch der Namen eines Feldes daran. Über das gleiche Unglück, allerdings ohne Nennung von Tidenheim, berichtete schon 1731 Johann Adam Bernhard in seinen Antiquitates Wetteravae und gibt sogar zwei Quellen an, in denen diese Nachricht enthalten sei. Eine mögliche Lokalisierung bot 1865 Friedrich Scharff, der zwar feststellt, das Tidenheimer Feld lasse sich nicht belegen, sich dann aber auf den Bürgermeister Kuntz bezieht. Von diesem habe er erfahren, dass sich in einem bestimmten Bereich, dessen Flurnamen er angibt, "Basalt- und Ziegelsteine" im Boden gefunden hätten, die auf eine kleine Kirche oder Kapelle hindeuten könnten. Friedrich Kofler bestritt rund 40 Jahre später die Angaben Vogels und berief sich hinsichtlich des an Tidenheim erinnernden Feldes (ohne Scharffs' Hinweis zu erwähnen) auf einen von ihm befragten Eschborner Pfarrer, dem es unbekannt war. Die in den letzten Jahren herausgegebene Flurnamenkarte der Historischen Gesellschaft Eschborn für die Zeit vor 1887 zeigt ebenfalls nichts Ähnliches auf, wobei allerdings einschränkend zu sagen ist, dass dabei auch Grundstücksbezeichnungen mit „Chaussee“ und „Eisenbahn“ erscheinen, die nicht gerade auf ein hohes Alter dieser Flurnamen hinweisen, andererseits aber auch nichts über das Alter der übrigen aussagen. Kofler ortete sein „Dietigheim“ im Tal unterhalb des heutigen Bad Homburger Schlosses, das demnach nicht mit Vogels Tidenheim identisch sein kann. Er konnte seine Auffassung zusätzlich mit Schriftquellen untermauern, aus denen sich ergab, dass die ursprüngliche Bezeichnung des „Tals“ tatsächlich Dietigheim war. Auch in den „Eppsteinschen Lehensverzeichnissen“ wird Dietigheim als „iuxta Hohenberch“ bezeichnet, also in der Nähe von Homburg befindlich - dem heutigen Bad Homburg, das den Zusatz "Bad" erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts erhielt. Dies sagte jedoch nichts über das Alter der im Tal gelegenen Siedlung aus. Ausgrabungen im Jahre 2002 haben nun ergeben, dass die dortige Ansiedlung frühestens um 1300 entstanden ist. Verschiedene Umstände (zum Beispiel die Tatsache, dass "-heim"-Namen nur etwa bis Ende des 8. Jahrhunderts vergeben wurden, die Siedlung "Dietigheim" also schon lange vor 1300 existiert haben musste) deuten darauf hin, dass es sich um eine der im Mittelalter recht häufigen Umsiedlungen handelte. Es ist aber nicht ersichtlich, woher die Umsiedler kamen, da darüber keine direkten Schriftquellen vorliegen. Aus dem Tidenheim bei Eschborn kamen sie jedenfalls nicht, denn das war ja nach Vogels Angaben bereits 875 untergegangen. So ist wohl davon auszugehen, dass es ein zweites Dorf gab - jedoch wo? Lediglich als Vermutung existiert die Überlegung, Dietigheim könne in dem Areal mit dem Flurnamen „Hofstadt“ in Gonzenheim, einem Vorort östlich von Bad Homburg, gelegen haben. Kofler zitiert in seinem in Englisch geschriebenen Führer zu Homburg 1880 eine alte Sage, nach der Gonzenheim früher viel größer gewesen sei und dort auch eine Burg der homburgischen Ritter Brendel gelegen habe.
Eine Interpretation, dass Dietigheim mit der Brendelschen Burg nach Homburg "umgezogen" sein könnte, wäre zwar möglich, reicht allerdings kaum als überzeugender Beweis aus. Abweichend davon wird auch das Georgenfeld in der entgegengesetzten, westlichen Richtung als möglicher Standort von Dietigheim vermutet. Eine Klärung dieser Frage steht aus. Das Schloss Homburg in Bad Homburg vor der Höhe war die Residenz der Landgrafen von Hessen-Homburg und nach 1866 Sommerresidenz der preußischen Könige und deutschen Kaiser. Das Schloss hat die Gestalt eines Rechtecks - mit einer runden Ecke zum Schlosspark – bei einer Seitenlänge von 120 Metern (von Ost nach West) und 100 Metern (von Süd nach Nord). Der Gesamtbau ist in zwei Innenhöfe unterteilt: den unteren (begrenzt durch die Schlosskirche, den Uhrturm-, Hirschgang-, den Englischen Flügel und den überdachten ehemaligen Durchgang zur lutherischen Schlosskirche) und den oberen Hof (begrenzt durch Archiv-, Königs-, Hirschgang- und Bibliotheksflügel). Der obere Hof ist als nach Westen offene Terrasse angelegt und ermöglicht damit den Ausblick auf Taunus und Schlosspark. Er wird vom Weißen Turm, einem freistehenden Bergfried überragt, der im dritten Viertel des 14. Jahrhunderts erbaut wurde und heute das Wahrzeichen Bad Homburgs ist. Seine Gesamthöhe beträgt 48,11 m. Das erste Bauwerk auf dem Bergrücken, auf dem sich das heutige Bad Homburger Schloss befindet, war ein leichter Pfostenbau, der anhand von 14C-Datierungen in die Zeit der Ersterwähnung von Ortwin von Hohenberch (auch: Wortwin von Hohenberch; als Schreibweise sind beide Fassungen überliefert) um 1180 eingeordnet werden kann. Dieses Bauwerk brannte nach kurzer Nutzungszeit ab oder wurde abgerissen und durch ein Gebäude in Fachwerktechnik ersetzt. Es hatte rund 100 Jahre Bestand, bis es ebenfalls abbrannte und von den Brendels, Dienstmannen der Herren von Eppstein, in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhundert durch eine in Stein erbaute Burg ersetzt wurde. Aus dieser Zeit stammt auch der Bergfried, der heutige „Weiße Turm“. 1680 ließ Landgraf Friedrich II. die Burg abreißen, nur der Bergfried blieb erhalten. Unter der Bauleitung von Paul Andrich wurde von 1680 bis 1685 das Homburger Schloss errichtet. Die lange vertretene Vermutung, das Schloss sei „aus einem Guss“ gebaut, lässt sich nicht halten; denn selbstverständlich wurde (wie durch Grabungen nachgewiesen) auf vorhandene Baubestandteile zurückgegriffen. Angesichts der knappen Geldverhältnisse wurde dem Schloss im 18. Jahrhundert wenig bauliche Sorgfalt zu Teil. Gigantische Umbaupläne, etwa von Louis Remy de la Fosse, blieben unausgeführt. Einzig die Einrichtung des so genannten „Spiegelkabinetts“ – ein Hochzeitsgeschenk der Homburger Schreinerzunft anlässlich der Vermählung des Landgrafen Friedrich III. mit Christiane Charlotte von Nassau-Ottweiler im Jahre 1728 – sei an dieser Stelle erwähnt. 1818 heiratete Erbprinz Friedrich, der nachmalige Landgraf Friedrich VI. die Prinzessin Elisabeth von Großbritannien und Irland. Die „englische Landgräfin“ brachte eine stattliche Mitgift in die Ehe ein. Schon bald nach Friedrichs Regierungsantritt (1820) ging man an den Umbau des Schlosses. Unter der Bauleitung von Georg Moller wurde in rund 20 Jahren das Schloss zu einem standesgemäßen Wohnsitz im Stil des deutschen Klassizismus ausgebaut.
Nach dem Krieg von 1866 trat Hessen-Darmstadt die gerade durch den Erbvertrag zwischen dem letzten Homburger Landgrafen Ferdinand und Großherzog Ludwig III. erworbene Landgrafschaft Hessen-Homburg an Preußen ab. Kaiser Wilhelm I. hielt sich ein paar Mal hier auf, ebenso sein Sohn und Nachfolger Friedrich III. mit Gattin Victoria. Ein besonderes Faible aber besaß Wilhelm II. für das Homburger Schloss, das von ihm und seiner Familie gern als Sommerresidenz genutzt wurde. Zahlreiche Umbaumaßnahmen und Neugestaltungen unter Wahrung der historischen Bausubstanz wurden durch den kaiserlichen Hofarchitekten Louis Jacobi vorgenommen: Einbau von Bädern und Wasserklosetts, Verlegung elektrischer Leitungen, Telefonzimmer und Zusammenlegung mehrerer Räume. 1901 wurde die so genannte „Romanische Halle“ an den Bibliotheksflügel angebaut. Kapitelle des säkularisierten Klosters Brauweiler dienen als Unterbau einer Terrasse auf der der Kaiser gerne den Tee zu sich genommen haben soll. Nach 1918 kam das Schloss unter die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten in Preußen, nach 1945 in die der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten in Hessen, die seit 1947 auch hier ihren Sitz hat. Wegen gravierender statischer Probleme muss der der Königsflügel, der Trakt mit der Wohnung der letzten deutschen Kaiserfamilie, ab 21. Februar für mindestens zwei Jahre geschlossen bleiben. In dem eher nüchternen, so gar nicht in die Barockzeit passenden Bau bilden zwei Portale eine Ausnahme. Unteres Tor Zwei Pfeiler tragen den Architrav, versehen mit den Wappen Friedrichs II. und seiner beiden Gattinnen Gräfin Margarethe Brahe und Louise Elisabeth von Kurland. Zwei römische Krieger flankieren die Torwache und darüber steht die Statue eines Herkules bedeckt mit einem Löwenfell. Oberes Tor Über den Säulen rechts und links die Figuren des Mars und der Minerva und dann „ein wahrhaft barocker Gedanke“ (Fried Lübbecke) – aus einer Nische sprengt auf seinem Pferd in voller Rüstung der Landgraf, von Kriegsemblemen umgeben, heraus, unter ihm zwei nackte Gefangene. Es handelt sich um eine Arbeit von Zacharias Juncker d. J.. Zeitgeschichtlich interessant ist der „Englische Flügel“. In fast reinem Spätklassizismus präsentiert sich das Ensemble in dem Elisabeth und Friedrich VI. wohnen wollten. Gegen 1820 hatte sich das Paar im Uhrturmflügel eingerichtet. Der Tod des Landgrafen 1829 hätte dieser Absicht eigentlich ein Ende setzen müssen. Trotzdem wurde das Vorhaben zu Ende geführt und Elisabeth richtete sich ein „Wohnappartement“ ein. Von besonderer Ausdruckskraft ist der Speisesaal mit herrlichen Wandmalereien im „pompeijanischen Stil“. Auch moderne Hygiene hielt mit einem „Wasserklosett“ (absolut neuzeit-ökologisch mit Regenwasserzisterne) Einzug. Dieser Flügel des Schlosses war seit 1965 wegen Baufälligkeit geschlossen, wurde aber 1995 anlässlich des 225. Geburtstags der „englischen Landgräfin“ wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Schlosskirche ist in einen Flügel des Schlosses integriert und als Hallenkirche gebaut. Nach ihrer Einweihung im Jahre 1697 war die Schlosskirche bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts zugleich die evangelisch-lutherische Stadtkirche. Mit dem Bau der Erlöserkirche im Jahre 1908 wurde die Schlosskirche entwidmet, geriet in Vergessenheit und verfiel. Erst 1982 formierte sich eine Bürgerinitiative, die die Wiederherstellung der Kirche vorantrieb. Im Kircheninneren dominieren die zweigeschossigen Emporen, die mit biblischen Motiven geschmückt sind. Über dem Chorraum stellt ein Gemälde von Karl Begas (1794–1854) Jesus Christus dar, der den Untergang Jerusalems prophezeit.
In den Gewölben der Schlosskirche unter dem Chorraum befindet sich die Familiengruft der Landgrafen. Mit der Beisetzung des letzten Hessen-Homburgischen Landgrafen Ferdinand füllte sich der letzte freie Platz der Grabkammer. Die Abdeckung des Grufteinganges ist eine Bronzeplatte, die von dem Künstler Horst Hoheisel (Kassel) geschaffen wurde. Auf dieser Platte befindet sich der Beginn des Gedichtes "Patmos" von Friedrich Hölderlin aus dem Jahre 1802.
Im Zuge der Sanierung wurde auch die Orgel rekonstruiert, die im Jahre 1787 von dem Orgelbauer Johann Conrad Bürgy (Homburg) erbaut worden war, und von der nur noch der Prospekt erhalten war. Sie dient heute als eines der Instrumente des internationalen Orgel-Festivals „Fugato“ in Bad Homburg. Das Instrument wurde originalgetreu wiederhergestellt, einschließlich der historischen Windanlage, deren sechs Keil-Blasebälge durch Kalkaten bedient werden. Das rein mechanische Schleifladen-Instrument hat 38 Register auf drei Manualen und Pedal. Bemerkenswert ist das Echowerk, dessen Windladen und Pfeifen im unteren Teil des Orgelgehäuses untergebracht sind. Der erste Garten wird 1441 im Zusammenhang mit der Burg erwähnt. Im 17. Jahrhundert wurde zeitgleich mit dem Umbau des Schlosses ab 1679 ein regelmäßiger Garten angelegt.
Der Hofgärtner Johann Adam Wittmann gestaltete den Garten ab 1770 in einen Landschaftspark nach englischem Vorbild um. Im 19. Jahrhundert wurde der Garten mit exotischen Gehölzen bepflanzt und die Wegeführung vereinfacht. Aus dieser Zeit stammen auch die berühmten Libanonzedern, die Landgräfin Elisabeth um 1820 aus den englischen Kew Gardens bezogen hatte. Ab 1866 verwaltete die preußische Hofgartendirektion den Garten und ließ ab 1870 auch wieder regelmäßige Pflanzungen (Teppichbeete) anlegen. Horex war eine deutsche Motorradmarke der „Horex-Fahrzeugbau AG“, die 1923 von Fritz Kleemann in Bad Homburg vor der Höhe in Hessen gegründet wurde. Der Markenname Horex entstand aus Homburg, ergänzt um das Warenzeichen „REX“ der elterlichen „REX-Konservenglasgesellschaft Bad Homburg“. 1960 übernahm die Daimler-Benz AG die Firma und löste sie auf. Seit 2010 besitzt die neu gegründete Horex GmbH in Augsburg die Markenrechte und baut wieder Motorräder. Friedrich Kleemann kaufte 1920 die kleine Motorenfabrik „Columbus-Motorenbau AG“ in Oberursel (Taunus). Zuerst wurde dort der „Gnom“, ein 1-PS-Fahrrad-Hilfsmotor, gebaut. Er wurde direkt vor dem Tretlager im Fahrrad befestigt. Schon 1923, im Gründungsjahr der „Horex-Fahrzeugbau AG“, baute der 1901 geborene, damals 22-jährige Fritz Kleemann – Friedrichs Sohn – die erste richtige Horex, eine 248-cm³-Maschine, die sich auch im Rennsport bewährte. Der Zylinder aus Leichtmetall mit eingeschrumpfter Laufbuchse verhalf ihm zu ersten Rennsiegen. Leitspruch war: „Gebaut von Motorradfahrern für Motorradfahrer“. 1925 fusionierten Columbus und Horex, um die finanziellen Probleme der beiden Betriebe zu lösen. Im Laufe der Jahre entstand ein Programm, das Motorräder mit einem Hubraum von 250 bis 800 cm³ umfasste. Eine richtungsweisende Konstruktion von Hermann Reeb, der 1927 zu Horex gekommen war, stellte der 1932 entworfene Parallel-Zweizylinder mit obenliegender Nockenwelle dar. Dieser langhubige Motor hatte eine dreifach gelagerte Kurbel- und Nockenwelle, die durch eine Kette an der rechten Gehäuseseite angetrieben wurde. Die Motoren hatten serienmäßig 90 mm Hub. So ergaben sich mit 65 mm Bohrung etwa 600 cm³ Hubraum und ca. 24 PS bei 5000/min; beim „S 600“ mit 75 mm Bohrung wurden etwa 800 cm³ und 30 PS bei 5000/min erreicht. Während dieses Triebwerk im Motorsport recht erfolgreich war, wurde die Serienproduktion aus Kostengründen zu Gunsten von Einzylindern aufgegeben, jedoch weiter für die Tornax „Tornado“ geliefert. Zu den sportlichen Erfolgen zählt die deutsche Meisterschaft von Karl Braun in der Gespannklasse, der den Motor auf 1 Liter Hubraum (80 mm × 99 mm) vergrößerte und ein Gebläse zwecks Aufladung montierte. 1936/38 entstand unter den beiden Konstrukteuren Richard Küchen und Hermann Reeb der 350-cm³-Langhub-Viertaktmotor „SB 35“, der seiner Zeit weit voraus war. Er wurde bis Kriegsbeginn mit einigen Änderungen und um 2 PS gesteigerter Leistung auch an die Nürnberger Firma Victoria für die Modelle KR 35-SN, KR 35-SS und KR 35-WH geliefert. Während des Zweiten Weltkrieges ruhte die Motorradproduktion, nach Kriegsende konnte 1948 wieder das Modell SB 35 gefertigt werden, die zuletzt in die Schweiz gelieferten Exemplare hatten schon eine Teleskopgabel statt der Trapezgabel, aber weiterhin keine Hinterradfederung. 1950 kam als Weiterentwicklung der SB 35 die „Regina“ mit Teleskopgabel und Geradweg-Hinterradfederung auf den Markt. Das Motorrad mit dem 350-cm³-Einzylindermotor war das erfolgreichste Horex-Motorrad. 1953 war sie mit 18.600 gebauten Exemplaren die meistverkaufte 350er der Welt. Zusätzlich zur 350er erschienen 1953 eine 250er „Regina“, die zunächst nur für Österreich und die Schweiz bestimmt war, und eine 400er. Die 250er mit einer Leistung von 17 PS bei 6500/min hatte im Gegensatz zu den größeren Modellen nur einen Auspuff („Einport“). Die 400er Ausführung mit 22 PS bei 5750/min galt als besonders für den Seitenwagenbetrieb geeignet. Im Laufe der Produktionszeit wurden zwecks Modellpflege viele Details überarbeitet, z. B. wurde der Nockenwellenantrieb mehrfach geändert, und der Zylinderkopf der letzten Reginas besteht aus Leichtmetall. Die Leistung der 350er Regina wurde von 18 PS bei 5800/min im Jahr 1950 auf 19 PS bei 6200/min 1953 verbessert. Zuvor hatte es als Modell „Regina Sport“ schon eine Variante mit Einport-Leichtmetallzylinderkopf gegeben, die 20 PS leistete. Alle Reginas haben 19-zöllige Laufräder. 1951 stellte Horex das Zweizylindermodell „Imperator“ mit 500-cm³-Motor und obenliegender Nockenwelle im Leichtmetallzylinderkopf vor. Bei einer Nennleistung von 30 PS bei 6800/min wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h angekündigt. Die sechs hergestellten Exemplare gingen jedoch nicht in den Verkauf, sondern dienten der Erprobung im Motorsport. Die Serienproduktion begann erst 1954 nach Hubraumverkleinerung auf 392 cm³, was noch für 26 PS bei 5800/min reichte. Eine auf 18 PS gedrosselte Version wurde auch als Stationärmotor(Stamo) abgesetzt. Die Imperator wurde wahlweise mit Telegabel oder Vorderradschwinge ausgeliefert. In den letzten Jahren der Horex-Produktion wurde der Motor wieder vergrößert und zwar bei quadratischem Hub-Bohrungsverhältnis (66 mm) auf 450 cm³. Dieser Motor erreichte 30 PS bei 5700/min, das Motorrad wurde als „Zündapp Citation“ in die USA exportiert, jedoch konnten wegen Rechtsstreitigkeiten, die die Verwendung der Markennamen „Horex“ und „Zündapp“ in den USA betrafen, dort nur etwa 250 Stück verkauft werden. Der Rest wurde verramscht und verschrottet, mehrere Exemplare und einige Werkzeuge gingen an Friedel Münch. Beim Imperator-Motor liegt der Antrieb der obenliegenden Nockenwelle zwischen beiden Zylindern. Diese Anordnung ließ sich Hermann Reeb allgemein für Zwei- und Mehrzylindermotoren unabhängig von der Art des Antriebs (Königswelle, Kette) patentieren. Die Patentanmeldung erfolgte am 22. August 1950, die Patenterteilung wurde am 10. September 1953 bekanntgemacht (Patentschrift DE 893875, vergl. Yamaha XS 650). Der Nockenwellenantrieb des serienmäßigen Imperator-Motors verwendet eine Kette mit hydraulischem Spanner. 1955 erschien als Nachfolger der „Regina“ die „Horex Resident“ mit Hinterradschwinge und wahlweise Vorderradschwinge oder Telegabel und leistungsgesteigerten Motoren von 250 und 350 cm³ Hubraum. Das Gehäuse der Resident-OHV-Motoren ähnelt dem Imperator-OHC-Motor stärker, als das bei den Reginas der Fall war. Die technisch wesentliche Verbesserung liegt im geänderten Hub-Bohrungs-Verhältnis zwecks Verringerung der bei Höchstleistung erreichten Kolbengeschwindigkeit; beide Motoren haben 77 mm Bohrung, der 250er aber nur 53,4 mm Hub statt 75 mm des 350ers. Somit konnte der 250er Motor auf 18,5 PS bei 7300/min, der 350er auf 24 PS bei 6250/min gesteigert werden. Die untenliegende Nockenwelle betätigt die Stoßstangen über Stößel, während bei den meisten Regina- und allen SB 35-Motoren hierfür Schlepphebel vorgesehen waren. Alle Resident-Motorräder haben 19-zöllige Laufräder. Wegen Absatzschwierigkeiten beendete Horex 1956 die Motorradproduktion; ein Restbestand des Modells „Imperator“ wurde in den USA vom Importeur unter dem Namen Zündapp mit entsprechenden Zeichen am Tank bis Anfang der 1960er-Jahre verkauft. Pläne, aus dem Imperator-Motor ein Flugtriebwerk zu entwickeln, konnten nicht mehr realisiert werden. 1960 übernahm der Daimler-Benz-Konzern die Werksanlagen, für den Horex schon zuvor einige Teile gefertigt hatte. Nach der Firmenschließung in Bad Homburg gingen die Namensrechte von der Familie Kleemann an Friedel Münch, den Gründer der Münch Motorradfabrik GmbH. Er stellte unter dem Namen Horex 1400 TI ein Liebhabermotorrad in Einzelanfertigung her. Münch verkaufte die Rechte an den Zweiradimporteur Fritz Röth aus Hammelbach im Odenwald. Dieser ließ in der 1980er-Jahren sowohl Mofas und Mokicks als auch Enduros und Straßenmaschinen unter dem Namen Horex mit italienischen Fahrwerken und Einbaumotoren verschiedener Hersteller fertigen. Röth gab den Namen an die Berliner „Bajaj-Motorfahrzeug-Vertriebsgesellschaft“ weiter, die von 1990 bis 1998 Inhaber der Marke Horex war. Unter dem Namen „MZ-B Horex“ wurden in einer Kleinserie Fahrzeuge mit den Namen „Regent“ und „Imperator“ gefertigt. Diese Fahrzeuge hatten jedoch keine technische Verwandtschaft mit den klassischen Horex-Motorrädern, sondern wurden überwiegend aus MZ- und Jawa-Fahrzeugteilen zusammengestellt. Bis 2009 besaß die HÖRMANN-RAWEMA GmbH in Chemnitz die Markenrechte und fertigte und rekonstruierte historische Horex-Motorräder. Die aktuellen Informationen zur Wort- und Bildmarke Horex bietet das Deutsche Patent- und Markenamt in München. Am 15. Juni 2010 stellte die HOREX GmbH auf einer Pressekonferenz eine HOREX VR6 vor und kündigte an, dieses Motorrad ab 2011 zu produzieren. Diese neue Horex soll von einem Sechszylinder-VR-Motor mit einem Zylinderwinkel von 15° angetrieben werden. Der nur ca. 430 mm breite 1218-cm³-Dreiventil-Viertaktmotor wird etwa 120 kW (160 PS) leisten und eine voraussichtlich auf 250 km/h begrenzte Höchstgeschwindigkeit ermöglichen. Eine weitere Besonderheit stellen die einseitig schräg ausgebildeten Kolbenböden dar, sodass die unteren Grenzflächen aller Brennräume in einer Ebene liegen und bei radialer Anordnung der Ventile eine nahezu parallele Lage aller Einlasskanäle möglich wird; dadurch können die insgesamt 18 Ventile von drei obenliegenden Nockenwellen direkt angetrieben werden, was die werbetechnische Bezeichnung „TOHC“ (triple overhead camshaft) erklärt. Die mittlere Nockenwelle betätigt Ventile beider Zylinderbänke. Die Antriebskraft wird vom 6-Gang-Getriebe mittels Kette auf das an einer Einarmschwinge (mit Zentralfederbein) geführte 17-Zoll-Hinterrad übertragen. Der Brückenrahmen besteht aus Aluminium mit einem Stahl-Lenkkopf. Für viele Details der HOREX VR6 wurden dem Maschinenbauingenieur Clemens Neese, Geschäftsführer der heutigen HOREX GmbH, Patente erteilt. Der Verkaufspreis der neuen Horex wird über 20.000 Euro liegen. Der ursprüngliche Plan, den Motor durch einen Kompressor aufzuladen, wurde ebenso aufgegeben wie der Sekundärantrieb mit Zahnriemen. Das Design stammt vom deutschen Designer Peter Naumann. Am 14. Januar 2011 kündigte die Horex GmbH an, dass das neue Motorrad nicht in Bad Homburg, sondern in Augsburg gebaut werden wird. Ein Umzug des Unternehmens nach Augsburg sei für Mitte des Jahres geplant. Durch die Erwähnung in den Werner-Comics des Zeichners Rötger „Brösel“ Feldmann wurde die Marke Horex in den 1980er Jahren auch damals jüngeren Bevölkerungsschichten bekannt. Comicfigur Werner verbaute mit seinem Kumpel Ölfuss unter anderem vier hintereinandergeschaltete Horex-Motoren in einem Drag Bike, genannt „Red Porsche Killer“. Außerdem fuhr Werner in diversen Bänden eine Horex Regina. Der „Red Porsche Killer“, der dem Comic entstammte, wurde später auch in der Realität nachgebaut. |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Bad Homburg vor der Höhe aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Dem Artikel Villa Tidenheim aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Dem Artikel Schloss Bad Homburg aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Dem Artikel Horex aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. |